
Hobbyzüchter betrachten sie als ihren engsten Sportsfreund, Taubengegner hingegen bekämpfen die "Ratten der Lüfte". Das Verhältnis von Mensch und Taube war stets von Gegensätzen geprägt: Während die einen dem gefiederten Boten überlebenswichtige Nachrichten anvertrauten, landeten die Tiere bei anderen auf dem Teller. In einem sind sich aber alle einig: Über Kulturgrenzen hinweg gelten Tauben auch als Symbol für Liebe und Frieden.

"Bau eine Arche", befiehlt Gott im Alten Testament dem Familienvater Noah. Denn der Herr hat beschlossen, die Menschen wegen ihrer Boshaftigkeit mit einer Sintflut zu vernichten und nur Noah und seine Familie zu schonen. Noah baut die Arche und nimmt von allen Tieren ein Pärchen mit an Bord. Dann brechen die Wassermassen über das Holzschiff herein. Nachdem die Flut alles Leben außerhalb der Arche vernichtet hat, lässt Gott das Wasser langsam wieder sinken. Da wählt Noah eines der Tiere an Bord aus, um es als Kundschafter auszusenden. Es ist eine Taube, die er durch das einzige Fenster der Arche hinausfliegen lässt.

Unverrichteter Dinge kehrt sie beim ersten Flug zurück. Beim zweiten aber bringt sie einen Ölzweig in ihrem Schnabel mit – und Noah schöpft Hoffnung. Vom dritten Flug schließlich kehrt die Taube nicht zurück. "Sie hat Land gefunden", jubelt Noah – und er lässt Menschen und Tiere von Bord, um die Erde erneut zu bevölkern. Seither steht die Taube symbolisch für die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Doch nicht nur in der Geschichte von der Sintflut kommt sie im Buch der Bücher vor. Eine weitere – für die Taube eher unschöne Rolle – hat sie als Opfertier im Tempel. Früher galten Tauben nämlich als kultisch rein. Zu höchster symbolischer Bedeutung gelangt die Taube im Neuen Testament: als Symbol für den Heiligen Geist.

Dass sich Pablo Picasso von Noahs Geschichte inspirieren ließ, als er das Plakat für den Pariser Weltfriedenskongress im Jahr 1949 entwarf, muss wohl unter der Rubrik Legenden verbucht werden. In Wirklichkeit soll der Aufstieg der Taube zum weltweiten Friedenssymbol ein Zufall gewesen sein: Der französische Schriftsteller Louis Aragon suchte ein Motiv für diesen ersten Kongress der Weltfriedensbewegung und wandte sich an seinen spanischen Freund Pablo Picasso. Er blätterte dessen Grafiken durch – und entschied sich für die weiße Taube, die dadurch zu so großer Berühmtheit gelangte. So große Pläne hatte Picasso mit dieser Arbeit wohl gar nicht gehabt. Er hatte einfach eine der beiden weißen Tauben auf Papier gebracht, die als Geschenk des Malers Henri Matisse in einem Käfig in seinem Atelier lebten. Die Taube ist seither das Flaggtier der Friedensbewegung. Und das, obwohl die Tiere sich dieser Auszeichnung nur bedingt würdig erweisen. Untereinander gehen sie nämlich häufig aggressiv aufeinander los. Eine Straßentaube wird schätzungsweise in 2000 Kämpfe pro Jahr verwickelt. Ihre ersten großen Auftritte hatte die Taube schon lange vor christlicher Zeit als Liebessymbol an der Seite von Göttinnen wie Venus und Aphrodite. Das kann kaum verwundern, wenn man sich das Balzverhalten der Tauben anschaut: Sie turteln wie Frischverliebte. Zudem leben Tauben meist ein Leben lang monogam – Seitensprünge sind allerdings nicht ausgeschlossen.

Wer beim Thema Tauben nur an die gemeine Stadttaube denkt, hat weit gefehlt: Es gibt mehr als 300 verschiedene Arten, rund 500 Millionen Exemplare leben fast auf der ganzen Welt verteilt. Die gemeinsame Geschichte von Taube und Mensch beginnt vor etwa 5000 Jahren. Zu dieser Zeit lebte die Taube in Felsen an den Küsten des Atlantischen und Pazifischen Ozeans. Doch dann fingen Menschen an, dort Häuser zu bauen und Getreide anzupflanzen – und die Felsentauben, angelockt von diesem körnigen Festmahl, suchten die Nähe des Menschen.

Die Sumerer hielten die Tauben als Fleischlieferanten und Lockvögel, um Greifvögel zu fangen. Die alten Ägypter schätzten die Tauben vor allem wegen ihrer Exkremente, denn Taubenkot eignet sich gut zum Düngen. Die Römer hielten die Tiere in riesigen Taubenschlägen – um sie als Delikatessen zu verspeisen. Bald schon erkannte man auch die Qualität der Vögel als gefiederter Bote. Denn Tauben sind zum einen schnell – sie erreichen bis zu 160 Kilometer pro Stunde. Zum anderen haben sie eine hervorragende Orientierung und einen starken Trieb, in ihren Heimatschlag zurückzukehren. Die Araber waren im neunten Jahrhundert die ersten, die auf die Idee kamen, diese Fähigkeit der Tauben im großen Stil zu nutzen. Sie richteten eine professionelle Taubenpost ein, indem sie in allen Städten, die an das Postnetz angeschlossen werden sollten, große Schläge aufbauten. Während der Kreuzzüge konnten sich die arabischen Heere so auf ein gut funktionierendes Nachrichtensystem verlassen.

Gut tausend Jahre später gelangt eine Brieftaube zu großer Berühmtheit: Es ist der 4. Oktober 1918, in den letzten Tagen des Ersten Weltkrieges. Der amerikanische Major Charles White Whittlesey und etwa 500 seiner Männer werden in der Nähe der französischen Stadt Verdun hinter den feindlichen Linien eingeschlossen. An einem Tag sterben 300 Mann. Die amerikanische Artillerie nimmt die Deutschen unter Beschuss – doch weiß niemand genau, wo Whittlesey und seine verbliebenen Männer sich befinden. So werden sie von ihren eigenen Leute beschossen. Major Whittlesey bleibt noch eine letzte Hoffnung: die Brieftaube "Cher ami", zu deutsch "Lieber Freund". Tausende solcher Tauben wurden im Ersten Weltkrieg auf allen Seiten an der Front eingesetzt, doch keine hat so von sich reden gemacht wie "Cher ami". Denn die kleine Taube wird an diesem 4. Oktober auf ihrem Flug schwer verletzt. Eine Kugel trifft sie an der Brust, eine weitere verletzt ihr Bein. Trotzdem schafft "Cher ami" den Weg ins amerikanische Lager – 25 Kilometer fliegt sie in nur 25 Minuten. Der Soldat, der sie entdeckt, findet an ihrem Bein Whittleseys Nachricht: "Our own artillery is dropping a barrage directly on us. For heaven's sake, stop it." ("Unsere eigene Artillerie hat uns unter Beschuss. Um Himmels Willen, hört damit auf!") 194 Soldaten rettet "Cher ami" so das Leben. Von den Franzosen erhält die Brieftaube dafür den Militärorden "Croix de Guerre". Und als "Cher ami" ein Jahr später ihren Verletzungen erliegt, wird sie ausgestopft und kann bis heute im Nationalmuseum für amerikanische Geschichte in Washington bewundert werden.
Viele Menschen lieben die gefiederten Tiere. Seien es diejenigen, die ihnen auf Plätzen und in Parks Futter hinstreuen. Oder diejenigen, die sich dem Taubensport verschrieben haben. Rund 40.000 Menschen gehen allein in Deutschland diesem Hobby nach. Taubengegner beklagen auf der anderen Seite die Taubenplage in den Städten. Als "Ratten der Lüfte" werden die Tiere beschimpft, weil die Menschen sich ärgern über Taubenkot und Lärmbelästigung. Doch was sie auch tun, ob sie Drahtstacheln aufstellen oder Rattengift ausstreuen, den Taubenbeständen können sie auf Dauer nichts anhaben. Bis zu zehn Mal im Jahr vermehren sich Tauben. Nach 18 Tagen schlüpfen die in der Regel ein bis zwei Jungen. Bereits mit vier Wochen lernen sie fliegen, nach sechs Monaten können sie sich fortpflanzen. Die Tauben leben von den Resten unserer Wohlstandsgesellschaft, bauen Nester in den Drahtstacheln und vermehren sich weiter rasend schnell. 5000 Jahre Zusammenleben mit dem Menschen haben sie gelehrt, sich optimal anzupassen.
Das bei der Einmündung der Mühlegasse aufragende Gasthaus „Zur Taube“ beherrscht zusammen mit dem benachbarten alten Schulhaus das Mitteldorf. Seit 1973 ist die „Taube“ der letzte historische Gasthof von Zeiningen. Das 1987 fachgerecht restaurierte Tavernenschild im Louis XVI-Stil steht unter kantonalem Denkmalschutz.Der traufseitige Zugang zur Gaststube im Obergeschoss bewahrt das originale spätbarocke Stichbogengewände samt dem schmucken zugehörigen Eichentürblatt.
Wir danken der Denkmalpflege des Kanton Aargau und der Gemeindeverwaltung von Zeiningen für die Information, welche sie uns zur Verfügung stellten, für unsere Website www.taube-zeiningen.ch .
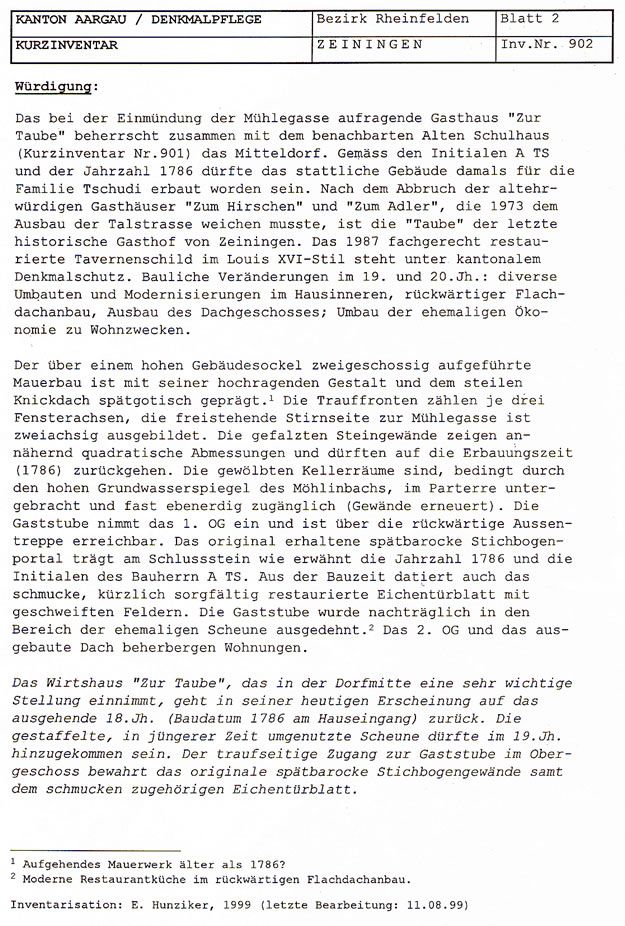
 Im Gasthaus zur Taube in Zeiningen haben die Gesellen seit Jahren ihre Herberge.
Im Gasthaus zur Taube in Zeiningen haben die Gesellen seit Jahren ihre Herberge.
Die Wanderjahre, auch als Walz, Tippelei oder Gesellenwanderung bezeichnet, beziehen sich auf die Wanderschaft zünftiger Gesellen. Sie umfassen die Zeit des Wanderns der Gesellen nach dem Abschluss ihrer Lehrzeit (Freisprechung). Die Wanderschaft war seit dem Spätmittelalter bis zur beginnenden Industrialisierung eine der Voraussetzungen für den Gesellen, die Prüfung zum Meister zu beginnen. Die Gesellen sollten vor allem neue Arbeitspraktiken, Lebenserfahrung und fremde Orte, Regionen und Länder kennen lernen. Ein Handwerker, der sich auf dieser traditionellen Wanderschaft befindet, wird als Fremdgeschriebener oder Fremder bezeichnet. Unser heutiges Bild über die Gesellenwanderung ist häufig verklärt durch einzelne fragmentarische Überlieferungen, die sich überwiegend auf den Zeitraum des späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhunderts beziehen. Die Geschichte der Wanderschaft als Teil der Handwerks- und Industriegeschichte sowie der Migrationsforschung ist bislang nur in Bruchstücken rekonstruiert.
 Die "echte" Kluft der Gesellen (Fremde Freiheitsbrüder)
Die "echte" Kluft der Gesellen (Fremde Freiheitsbrüder)
Die Ausbildung begann mit der Lehre und endete mit der Gesellenprüfung. Der Zeitraum, den die Wanderschaft umfasste, unterschied sich über die Jahrhunderte, je nach Gewerk und Ort der Innung. Die Dauer war in den Artikeln der jeweiligen Zunft festgelegt. Nach dem Ablauf der Hälfte der Wanderjahre bestand die Möglichkeit, sich durch Angehörige als Anwärter auf die Meisterschaft im Buch der jeweiligen Innung eintragen zu lassen. Erst nach Beendigung der Wanderschaft und einer weiteren mehrjährigen Arbeitszeit, den so genannten Mutjahren in einer Werkstatt am Ort der Antragstellung, bestand die Möglichkeit, sich zum Meisterstück anzumelden. An die Erlangung der Meisterschaft war das Niederlassungsrecht gebunden und damit die Eintragung als Bürger in das Bürgerbuch der Stadt. Erst dann bestand die Möglichkeit der Heirat.
Die Wanderschaft war ein Teil des vorgeschriebenen Ausbildungsweges all derer, die dem Zunftzwang unterlagen. Frauen und Kleingewerbetreibende in den Vorstädten größerer Städte und Hofhandwerksleute standen im 18. Jahrhundert außerhalb des Zunftzwanges.
 Wanderbuch des Kürschners Albert Strauß, 1816
Wanderbuch des Kürschners Albert Strauß, 1816
Die bisherige Interpretation der Wanderschaft geht von zwei prinzipiell damit verbundenen Funktionen aus. Neben der Ausbildung, dem Wissenserwerb und dem damit verbundenen überregionalen Wissenstransfer waren die Regulierung des regionalen Arbeitsmarktes und die schwankenden Absatzbedingungen von Bedeutung.
 Das war 1990.
Das war 1990.
 Kochrezept Vogtländer Kartoffelklösse (anno 1898)
Kochrezept Vogtländer Kartoffelklösse (anno 1898)
Für eine Familie mit Vogtländer-Appetit schält man einen Napf, das sind 5 Liter, große, mehlige rohe Kartoffeln, reibt sie in eine Schüssel mit kaltem Wasser und lässt sie so 1 bis 2 Stunden stehen, indem man von Zeit zu Zeit das obere schaumige Wasser abschöpft und frisches zugießt. Dreiviertelstunde vor dem Gebrauche rührt man die Kartoffeln um, Geist sie durch einen festen groben Leinensack und drückt sie darin so fest aus, dass kein Wasser mehr abfließt. Dann nimmt man sie aus dem Sack, zerkrümelt den festen Klumpen und streut eine Hand voll Salz drauf. Nun werden die Kartoffeln mit Wasser gebrüht, doch nicht so, dass man das kochende Wasser einfach darauf Geist, nein, dabei muss man vorsichtig zu Werke gehen. Man schiebt also die Kartoffeln beiseite, hält die Schüssel etwas schräg, Geist einen Teil des Wassers auf einen freien Platz und verrührt mit dem Klosslöffel nach und nach etwas von den Kartoffeln mit dem Wasser, Geist neues kochendes Wasser zu, verrührt wieder und so fort, bis es ein ziemlich weicher Teig ist. Wie weich? Ja, das eben muss man "im Griff" haben, das lernt sich erst durch Übung, wenn es einem nicht angeboren ist. Also, in den ziemlich weichen Teig gibt man einen sehr gehäuften Suppenteller gekochte, geriebene Kartoffeln, vermischt alles gut und fängt nun an zu formen. Dazu taucht man die Hände in kaltes Wasser, nimmt einen Klumpen Teig, macht eine Vertiefung hinein, füllt diese mit einigen fett gerösteten Semmelwürfeln aus, schlägt Teig darüber und rundet die Klöße ab. Direkt aus der Hand werden sie in kochendes Salzwasser geworfen; darin müssen sie 20 Minuten kochen, dann gleich auf den Tisch kommen und gegessen werden, denn durch das Stehen werden sie hart.